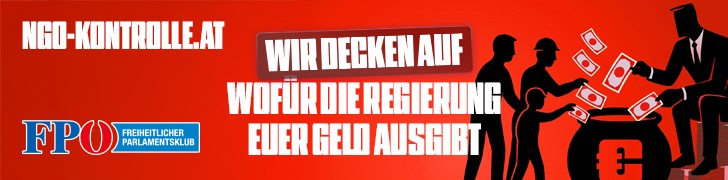Wie wurden die Bürger in Corona-Zeiten damit gequält nachzuweisen, nicht nur augenscheinlich gesund zu sein, sondern auch mittels sogenannter PCR-Tests.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Richtschnur für zwei Jahre
Mehr als zwei Jahre lang war die „7-Tage-Inzidenz“ – also die Anzahl neu gemeldeter PCR-Positiver pro 100.000 Einwohner – zentrale Richtschnur der Corona-Politik. Sie floss sogar direkt in das Infektionsschutzgesetz ein und war Grundlage für Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Zugangsbeschränkungen.
Geringe Verlässlichkeit der PCR-Tests
Eine neue Auswertung von Labor-Daten zeigt nun, dass nur ein Bruchteil der Menschen mit positivem Corona-PCR-Test tatsächlich infiziert gewesen war, gemessen daran, ob die Getesteten später messbare IgG-Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelten.
Ausgangspunkt der Arbeit ist ein besonderer Datenschatz: Der Verband „Akkreditierte Labore in der Medizin“ (ALM) erfasste von März 2020 bis Anfang 2023 etwa 90 Prozent aller PCR-Tests in der Bundesrepublik Deutschland und bis Mai 2021 auch serologische IgG-Antikörpertests.
Vergleich von stabilen Daten
Die Autoren haben für den Zeitraum von Frühjahr 2020 bis Ende 2021 zwei Signale miteinander abgeglichen: Den wöchentlichen Anteil positiver PCR-Tests und den Anteil der Bürger mit nachweisbaren IgG-Antikörpern im Blut, also dem Hinweis auf eine durchgemachte Infektion oder Impfung.
Angenommen wurde, dass ein positiver PCR-Test zuverlässig eine Infektion anzeigt. Demnach müsste die aufsummierte Menge an PCR-Positiven zeitversetzt ziemlich genau die Entwicklung der IgG-Antikörper in der Bevölkerung widerspiegeln. Tat es aber nicht.
Wahrscheinlich nur in elf Prozent der Fälle richtig
Denn laut Studie entsprach nur etwa jede siebte Person mit positivem PCR-Test einer Person, die später IgG-Antikörper entwickelte und damit als „tatsächlich infiziert“ gewertet wurde.
Unter Berücksichtigung möglicher Auswahlverzerrungen, also wer überhaupt IgG testen ließ, sehen die Autoren eine „noch niedrigere, konservative Schätzung von nur rund elf Prozent“ als ebenfalls plausibel.
Absicherung der Ergebnisse
Parallel rechneten die Studienautoren mit einem zweiten, unabhängigen Ansatz aus der Literatur: In der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz wurden in früheren Arbeiten etwa „zehn tatsächliche Infektionen pro positivem PCR-Test“ angenommen. Daraus berechneten sie einen Infektionsverlauf für die Bevölkerung und verglichen ihn wieder mit den IgG-Daten.
Auch dieser Ansatz ergab eine Kurve, die gut zu den beobachteten Antikörperdaten und zu den später vom Robert-Koch-Institut (RKI) genannten Werten passte.
PCR-Tests – das große Geschäft
Deutschland setzte ab Frühjahr 2020 massiv auf PCR-Diagnostik. Laut der vom RKI geführten Tabelle zu „durchgeführten Tests und Testkapazitäten“ wurden bis Anfang 2023 über 150 Millionen PCR-Tests durchgeführt.
Die Kosten waren enorm: Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR gaben Staat und Krankenkassen bis Januar 2023 rund sechs Milliarden Euro allein für PCR-Tests aus. Die Testkapazitäten wurden schnell hochgefahren: Bereits im Herbst 2020 wurden zeitweise deutlich über eine Million PCR-Tests pro Woche durchgeführt, 2022 wurden in manchen Wochen mehr als 2,5 Millionen Menschen per PCR untersucht.
Verbot von Teilnahme am Berufs- und Privatleben
Für viele Menschen waren PCR-Tests mehr als eine reine medizinische Diagnostik – sie wurden zu einem Schlüssel zur Teilnahme am öffentlichen und privaten Leben.
Mit Einführung von 3G, 3G-Plus, 2G und 2G-Plus, also den Impfnachweisen, war der Zugang zu Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Sport oder teilweise auch zum Arbeitsplatz oft nur möglich, wenn man geimpft, genesen oder negativ getestet war. Oft war ausdrücklich ein PCR-Test vorgeschrieben – ein Schnelltest reichte nicht.
Kosten für nichts
Ein „negativer Test“ war vielerorts Voraussetzung, um selbst arbeiten gehen zu dürfen. Essen gehen, reisen oder an Veranstaltungen teilnehmen wurden im Privatleben eingeschränkt.
Mit der Zeit wurden kostenlose Tests eingeschränkt; wer als Ungeimpfter weiter am öffentlichen Leben teilnehmen wollte, musste oft regelmäßig kostenpflichtige Tests machen – ein zusätzlicher Druck zur Impfung.
Folgen eines positiven PCR-Tests
Ein positiver PCR-Test hatte weitreichende Konsequenzen: Positive PCR-Ergebnisse waren meldepflichtig nach Infektionsschutzgesetz. Die meisten Bundesländer verpflichteten positiv Getestete zu „häuslicher Isolation“, anfangs oft 14 Tage, später in der Regel zehn Tage, teilweise mit Möglichkeit zum „Freitesten“ nach sieben Tagen.
Auch Kontaktpersonen mussten über mehrere Tage in Quarantäne, was für Familien, Schulklassen und die Wirtschaft erhebliche Folgen hatte. Wer ein positives Ergebnis bekam, musste meist sofort aus dem Alltag ausscheiden, verlor für mehrere Tage die Bewegungsfreiheit und stand im Berufsleben unter Druck – auch wenn keine Symptome auftraten.
Abhängige Behörden
Das RKI hat den PCR-Test durchgängig als „Goldstandard“ bezeichnet und betont, dass bei korrekter Abnahme und Auswertung „falsch-positive Befunde selten“ seien. In der Praxis würden fragliche Ergebnisse meist durch Wiederholungstests überprüft.
Im offiziellen Überblick zur Testung heißt es, PCR-Tests hätten „eine hohe Sensitivität und Spezifität“, und die Zahl falsch-positiver Befunde sei so gering, dass sie die Lageeinschätzung nicht verfälsche.
Widerspruch zur Corona-Politik
Die neue Studie widerspricht dieser Sicht nicht direkt auf der Ebene des einzelnen Labor-Befundes, stellt aber die Gleichsetzung „PCR-positiv = infiziert“ im epidemiologischen und politischen Gebrauch infrage. Die Autoren argumentieren, dass die tatsächliche Infektionsdynamik besser aus Antikörperstudien ablesbar gewesen wäre – die Daten dazu lagen den Behörden vor, wurden aber weder beachtet noch kommuniziert.
Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass diese Inzidenzgröße „wissenschaftlich problematisch“ ist, weil sie stark von der Testhäufigkeit abhängt und nicht zwischen „PCR-positiv“ und „infiziert“ unterscheidet.