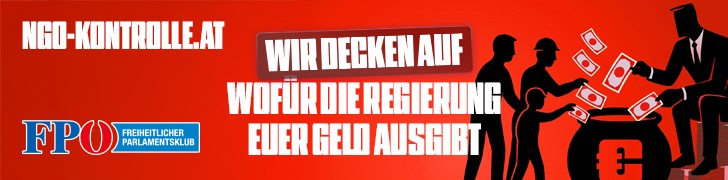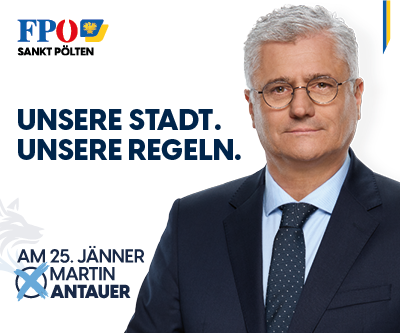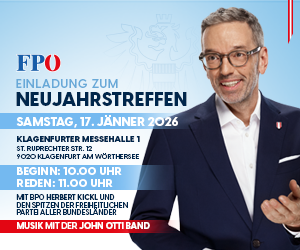Die Staatsverschuldung Österreichs hat zur Jahresmitte 2025 einen neuen Höchststand erreicht.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Schuldenquote jetzt 82,3 Prozent
Laut den gestern, Dienstag, veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria belief sich der öffentliche Schuldenstand Ende Juni auf 412,3 Milliarden Euro, um 17,5 Milliarden Euro mehr als noch zum Jahresende 2024. Die Schuldenquote kletterte damit nach 79,9 Prozent Ende des Vorjahres auf 82,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – und damit deutlich über den Maastricht-Grenzwert von 60 Prozent.
Defizit mehr als fünf Prozent des BIP
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Das öffentliche Defizit betrug im ersten Halbjahr 13,3 Milliarden Euro, das entspricht 5,3 Prozent des BIP. „Die Einnahmen des Staates sind zwar im Vorjahresvergleich um 3,2 Prozent gestiegen, gleichzeitig wuchsen die Ausgaben aber noch stärker, nämlich um 4,1 Prozent“, erklärte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.
Insbesondere höhere monetäre Sozialleistungen (plus 3,3 Milliarden Euro) sowie Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst (plus 1,3 Milliarden Euro) trieben die Ausgaben in die Höhe.
Immer höhere Zinslasten
Auch die Zinslast des Staates nahm weiter zu: Mit 3,9 Milliarden Euro lagen die Zinsausgaben um 15,5 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Rückläufig waren hingegen die Subventionen, vor allem wegen der auslaufenden Energiehilfen.
Einnahmen steigen langsamer als die Ausgaben
Die Staatseinnahmen summierten sich im ersten Halbjahr auf 123,4 Milliarden Euro, ein Plus von 3,8 Milliarden Euro. Rund 86 Prozent davon entfielen auf Steuern und Sozialbeiträge, die um 4,7 Prozent zulegten. Weniger dynamisch entwickelten sich hingegen die Produktionserlöse des Staates (plus 0,6 Prozent), während die Einnahmen aus Vermögenserträgen und laufenden Transfers sogar zurückgingen.
Bund als Haupttreiber der Verschuldung
Wie schon in den Vorperioden entfiel der größte Teil des Schuldenanstiegs auf den Bund, dessen Verbindlichkeiten um 15,8 Milliarden Euro zunahmen. Auch außerbudgetäre Einheiten verschuldeten sich stärker, vor allem im Zuge von Infrastruktur-Investitionen. Damit sind die zentralen Budgetentscheidungen von Bundesregierung und Nationalrat (Budgetbeschlüsse, Zusatzmittel, Krisenmaßnahmen etc.) hauptverantwortlich.
Aber auch Länder und Gemeinden schöpfen nicht vorhandenes Geld. Auf Länderebene stiegen die Verbindlichkeiten um 0,7 Milliarden Euro, in den Gemeinden um 1,1 Milliarden Euro. Der Sozialversicherungssektor verzeichnete hingegen einen vorübergehenden Rückgang der Schulden um 1,5 Milliarden Euro – ein Effekt, der laut Statistik Austria durch kurzfristige Finanzierungen typisch für diesen Bereich sei.