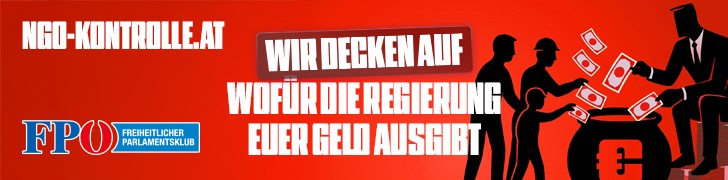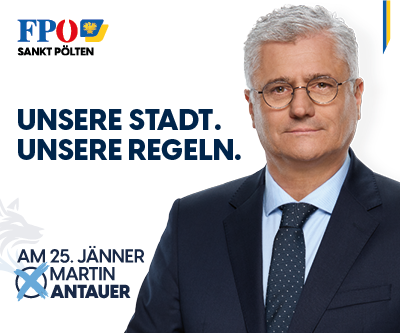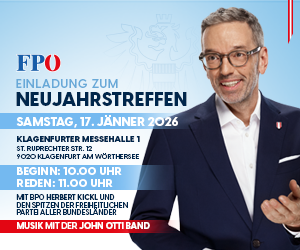Der Rechnungshof hat in seinem aktuellen Bericht zum „Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan“ (ÖARP) erhebliche Mängel bei der Umsetzung des milliardenschweren EU-Corona-Aufbaufonds festgestellt.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Nicht einmal Parlament informiert
Die Prüfer bemängeln insbesondere fehlende Transparenz, unklare Tilgungspläne und eine mangelhafte finanzielle Berichterstattung an den Nationalrat. Damit reiht sich Österreich in die Riege jener EU-Staaten ein, die mit der Umsetzung des sogenannten „NextGenerationEU“-Pakets kämpfen – einem Programm, das ursprünglich als Antwort auf die durch die Corona-Maßnahmen selbst verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten gedacht war.
Milliarden aus Brüssel – aber zu welchem Preis?
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Mit dem „NextGenerationEU“-Programm hat die Europäische Union ab 2020 insgesamt 750 Milliarden Euro Schulden aufgenommen – ein Mandat, das sie eigentlich gar nicht hat, da die EU über keine eigene Staatlichkeit verfügt.
Für Österreich bedeutete das: Zuschüsse in Höhe von bis zu 3,961 Milliarden Euro standen bereit. Auf Darlehen verzichtete man bewusst.
Nur Teil der Wahrheit
Doch wie der Rechnungshof nun feststellt, ist diese Summe nur ein Teil der Wahrheit: Um alle vereinbarten Meilensteine zu erreichen, waren laut Schätzungen vom Juli 2023 insgesamt rund 5,9 Milliarden Euro nötig – also deutlich mehr als aus Brüssel fließen konnte. Die Differenz musste der österreichische Steuerzahler aufbringen.
Doppel so viel ausgegeben wie erhalten
Bis Juni 2024 hatte der Bund bereits rund 2,65 Milliarden Euro in Projekte des ÖARP investiert; bis September desselben Jahres wurden von der EU-Kommission erst knapp 1,2 Milliarden Euro tatsächlich an Österreich überwiesen. Erst im Juli 2025 genehmigte Brüssel weitere Zahlungen von etwa 1,6 Milliarden Euro.
Tilgungsplan bleibt unklar
Ein zentrales Problem sieht der Rechnungshof in den fehlenden Klarheiten über die Rückzahlung der aufgenommenen Schulden.
Zwar ist festgelegt, dass die damalige schwarz-grüne Regierung den schwarzen Peter den nächsten Generationen umgehängt hat. Denn alle Mittel müssen erst bis spätestens Ende 2058 getilgt sein. Wie hoch die tatsächlichen Kosten für Österreich am Ende sein werden, weiß jedoch niemand genau.
Fast Verdreifachung der Kosten
Eine Schätzung des Finanzministeriums aus dem Jahr 2020 ging bereits damals von potenziellen Tilgungskosten in Höhe von mehr als zwölf Milliarden Euro (zu Preisen von 2018) aus.
Der Rechnungshof empfiehlt daher dringend einen verbindlichen Tilgungsplan sowie mehr Transparenz über die finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Nationalrat und damit auch gegenüber den Steuerzahlern.
Meilensteine oft verfehlt oder verspätet
Zum finanziellen Desaster gesellt sich das inhaltliche: Nur wenn bestimmte Reformen oder Investitionen nachweislich umgesetzt werden – etwa beim Breitbandausbau oder bei Klimaschutzmaßnahmen –, fließen weitere Gelder aus Brüssel. Doch auch hier zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Viele Vorgaben wurden erst im Laufe des Prozesses konkretisiert; manche Ministerien definierten ihre Ziele wenig zweckmäßig oder erreichten sie nicht beziehungsweise zumindest nicht fristgerecht.
Außer Spesen nichts gewesen
Die Folge: Das Finanzministerium konnte Zahlungsanträge nicht planmäßig stellen; es kam zu längeren Phasen nationaler Vorfinanzierung und erhöhtem Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Ressorts.
Kritik an mangelnder Kontrolle und Transparenz
Die Kritik des österreichischen Rechnungshofs deckt sich mit jener auf europäischer Ebene: Bereits im Mai dieses Jahres hatte der Europäische Rechnungshof gravierende Mängel beim gesamten Corona-Aufbaufonds festgestellt. Europaweit wurden rund 72 Prozent aller gesetzten Meilensteine nicht erreicht. Missbrauch konnte kaum verhindert werden, da die Kontrolle weitgehend bei den Nationalstaaten lag und eine effektive Überprüfungen durch die EU fehlten.
Statt zielgerichteter Hilfen für die Wirtschaft flossen viele Mittel direkt an staatliche Stellen oder Ministerien und versickerten in der Folge in dunklen Kanälen.
Politische Debatte um Schuldenunion entbrannt
Schon bei Beschlussfassung des Fonds im Jahr 2021 warnten Kritiker vor einer dauerhaften europäischen Schuldenunion. Besonders Vertreter der FPÖ befürchteten damals einen massiven Souveränitätsverlust für Österreich sowie eine dauerhafte Belastung künftiger Generationen durch hohe Rückzahlungen bis ins Jahr 2058.
Die damalige schwarz-grüne Bundesregierung hielt dagegen: Als kleine exportorientierte Volkswirtschaft profitiere Österreich vom wirtschaftlichen Aufschwung anderer Länder; zudem werde man jeden zustehenden Euro abrufen und investieren. Nichts davon ist eingetreten. Im Gegenteil. Die Warnungen trafen nicht nur ein, sondern haben sich auch noch verschlimmert.
Was bleibt? Viele offene Fragen
Mit Blick auf das Auslaufen des Programms im kommenden Jahr bleibt unklar, was die milliardenschweren Investitionen tatsächlich bewirkt haben – sowohl für Europa als Ganzes als auch für Österreich im Speziellen. Der österreichische Rechnungshof fordert jedenfalls mehr Transparenz bei künftigen Großprojekten dieser Art: Regelmäßige Berichte an den Nationalrat über finanzielle wie inhaltliche Fortschritte sollen sicherstellen, dass Steuergeld effizient eingesetzt wird und politische Verantwortung klar nachvollziehbar bleibt.
Ob dies gelingt? Die Erfahrungen mit dem Corona-Aufbaufonds lassen Zweifel angebracht erscheinen.