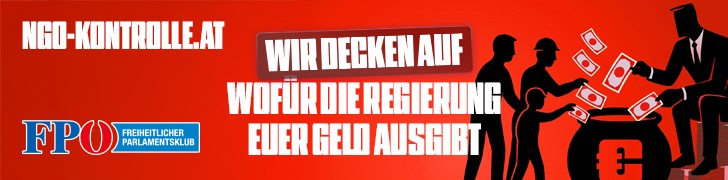Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt den digitalen Euro trotz zahlreicher Gegenstimmen immer weiter.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Pilotprojekt in einem guten Jahr
Nach vier Jahren intensiver Vorbereitung soll der digitale Euro spätestens 2029 eingeführt werden. Ein Pilotprojekt, an dem Banken, Handelsverbände und Verbraucherschützer beteiligt sind, soll bereits in einem guten Jahr starten. Die EZB veranschlagt dafür rund 1,3 Milliarden Euro, hinzu kommen jährlich über 300 Millionen Euro Betriebskosten.
Was fehlt, ist ein offizieller Beschluss der EU. Daran wird in den Hinterzimmern gearbeitet.
Scheibchenweise gegen Bargeld
Offiziell betont die Zentralbank, dass der digitale Euro kein Ersatz für Münzen und Scheine sei, sondern lediglich eine elektronische Ergänzung. Doch der Zeitpunkt ist brisant: Bargeld verliert in Europa zunehmend an Boden. In Österreich hat sich die Zahl der Bankfilialen in den letzten 20 Jahren um ein Drittel verringert. Mit der Abschaffung des 500 Euro-Scheins sowie der von der EU geplanten Bargeldobergrenze von 10.000 Euro werden anonyme Zahlungen immer schwieriger. Eine schleichende Entwertung des Bargelds – lange bevor der digitale Euro überhaupt existiert.
Zwei Versionen: Online und Offline
In Brüssel wird derzeit über zwei Varianten diskutiert. Eine Offline-Version soll wie digitales Bargeld funktionieren: Sie würde lokal auf einem Gerät gespeichert und könnte auch ohne Internetverbindung genutzt werden – von Person zu Person, ohne zentrale Überwachung. Diese Lösung gilt als datenschutzfreundlich, da sie keine zentralen Transaktionsdaten erzeugt und selbst bei Netzausfällen funktioniert.
Die Online-Version hingegen wäre ein kontobasiertes System, das über die Infrastruktur der EZB läuft. Sie erlaubt Zahlungen im Internet, im Einzelhandel oder zwischen Privatpersonen, ist aber mit Kontrolle durch die EZB verbunden.
Berichterstatter für Offline-Variante
Der konservative EU-Abgeordnete Fernando Navarrete Rojas, Berichterstatter des EU-Parlaments für den digitalen Euro und Leiter der Gesetzesverhandlungen, will die Online-Variante nur zulassen, wenn der Markt keine ausreichende private Alternative bietet. Stattdessen soll zunächst die Offline-Variante kommen.
Programmierbares Geld als Risiko
Die EZB setzt bei der Umsetzung auf eine Blockchain-Technologie mit sogenannten „Smart Contracts“. Diese können Zahlungen automatisch ausführen – etwa Mietüberweisungen oder Daueraufträge. Was technisch fortschrittlich klingt, birgt aber erhebliche Risiken: ein solche Programmierbarkeit ermöglicht es, Ausgaben zu beschränken oder Gelder mit Ablaufdaten zu versehen.
Totale Lenkung durch den Staat
In der Praxis könnten also bestimmte Käufe gesperrt oder Transaktionen nach politischen Kriterien eingeschränkt werden. Befürchtet wird ein Szenario, in dem der digitale Euro mit einem sozialen Kreditsystem verknüpft wird – etwa durch Belohnung oder Sanktionierung bestimmter Verhaltensweisen. Wer häufig fliegt, Fleisch isst oder sich regierungskritisch äußert, könnte in einem solchen System Nachteile erfahren.
Fragliche Notwendigkeit
Schon heute werden die meisten Geldgeschäfte digital abgewickelt – durch Online-Überweisungen, Kreditkarten oder mobile Bezahl-Apps. Der Unterschied liegt im Herausgeber: Der digitale Euro wäre Zentralbankgeld, also direkt von der EZB emittiert und nicht von privaten, unabhängigen und im Wettbewerb befindlichen Banken verwaltet.
Mit der Einführung eines digitalen Zentralbankgelds schafft sich die EZB ein Zahlungsmonopol, das traditionelle Banken verdrängt und Bürger ausschließlich und alternativlos an staatliche Strukturen bindet.
Unabhängigkeit von USA
Befürworter argumentieren, Europa müsse sich unabhängiger von US-Zahlungsriesen wie Visa, Mastercard oder PayPal machen. Diese dominieren derzeit den digitalen Zahlungsverkehr. Der digitale Euro solle hier die „strategische Souveränität“ Europas sichern.
Doch selbst innerhalb des EU-Parlaments gehen die Meinungen auseinander. Während Rojas auf Datenschutz und Systemstabilität pocht, warnt der grüne Abgeordnete Damian Boeselager, dass eine reine Offline-Lösung nicht zukunftsfähig sei. Sie funktioniere nur an der Ladenkasse, nicht im Onlinehandel, wo bereits die Hälfte aller Transaktionen stattfindet.
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“
Die offizielle Linie der EZB lautet, der digitale Euro solle freiwillig bleiben. Niemand werde gezwungen, ihn zu nutzen. Doch viele Beobachter verweisen auf die Erfahrung aus der Geschichte und der jüngeren Vergangenheit der Bargeldpolitik: Was einst freiwillig begann, ist heute vielerorts kaum noch möglich. Der Rückzug des Bargelds, die Schließung von Bankfilialen und neue Obergrenzen schaffen ein Umfeld, in dem das physische Geld zunehmend verdrängt wird – auch ohne gesetzliches Verbot.