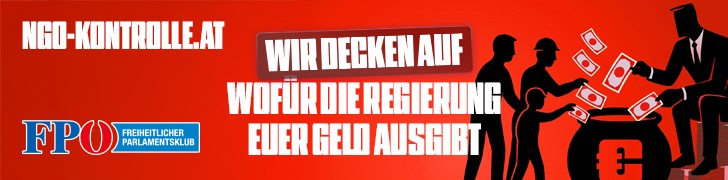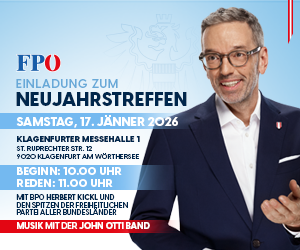Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet – gleich in zwei Fällen. Der Grund: Versäumnisse bei der Umsetzung zentraler EU-Richtlinien der Klimapolitik sowie zur Bekämpfung von Sanktionsumgehungen.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
Politische Entscheidungen ohne Österreicher
Im ersten Verfahren wirft die EU-Kommission Österreich vor, die überarbeitete, über die Köpfe der Österreicher entwickelte Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien nicht fristgerecht in nationales Recht umgesetzt zu haben. Die Vorschriften beinhalten unter anderem Maßnahmen zur Förderung erneuerbaren Wasserstoffs, zur Elektrifizierung des Energiesektors und zur nachhaltigen Nutzung von Bioenergie. Die Umsetzungsfrist endete am 21. Mai.
Sanktionsumgehen als Straftat
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
In einem zweiten Verfahren steht Österreich mit 17 weiteren Ländern am Pranger: Die EU bemängelt, dass nationale Regelungen zur Verhinderung der Umgehung von EU-Sanktionen gegen Russland nicht vollständig umgesetzt wurden. Brüssel hatte Verstöße gegen die EU-Sanktionen als Straftaten eingestuft. Hier lief die Umsetzungsfrist am 20. Mai aus.
Kritik aus der FPÖ: „Sanktionspolitik auf Irrweg“
Deutliche Kritik am Vertragsverletzungsverfahren kommt von FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky. Er wirft der Kommission vor, wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, um an einer „fragwürdigen Sanktionspolitik“ gegenüber Russland festzuhalten:
Die bisherigen 18 Sanktionspakete hätten der europäischen Wirtschaft massiv geschadet, ohne erkennbaren politischen Nutzen.
Einschüchterung mittels Rechtsverfahren
Besonders kritisiert er den Druck, den die Kommission auf jene Mitgliedstaaten ausübe, die nicht uneingeschränkt mitziehen wollen. „Man verlangt von uns Maßnahmen, die der eigenen Wirtschaft schaden, und wer sich dem nicht widerspruchslos beugt, wird durch Verfahren eingeschüchtert“, erklärte Vilimsky.
Aus seiner Sicht liege der „eigentliche Rechtsbruch“ nicht bei Österreich, sondern bei der Kommission selbst – diese entferne sich zunehmend von den Interessen der Bevölkerung.
Zwei Monate Frist für Stellungnahme
Die betroffenen Mitgliedstaaten haben nun zwei Monate Zeit, auf die Vorwürfe der Kommission zu reagieren. Gefällt Brüssel die Antwort nicht, kann die Kommission den nächsten Schritt einleiten – bis hin zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.